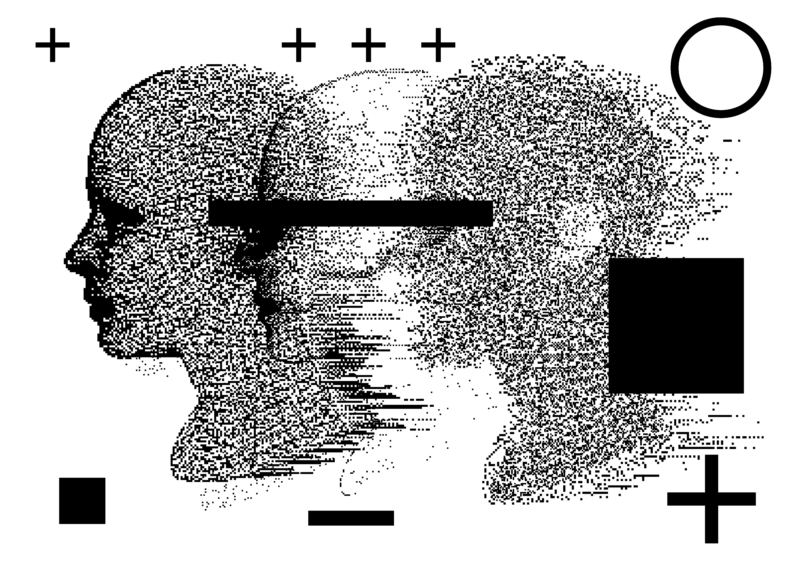[Ich dokumentiere hier meinen neuesten Beitrag in der Berliner Zeitung. Der Titel wurde zwischenzeitlich geändert, aber mit diesem wurde er ursprünglich veröffentlicht.]
Der Staat finanziert aktivistische Rassismusforschung mit Millionen. Die wissenschaftlichen Grundlagen sind dünn, Ergebnisse stehen schon vorher fest.
6.7.2022
Am Donnerstag soll Ferda Ataman Antidiskriminierungsbeauftrage der Bundesregierung werden. Ataman bezeichnet weiße Deutsche bekanntlich als „Kartoffeln“ und verdächtigt Krankenhäuser, Menschen mit Migrationshintergrund während der Pandemie als Letzte zu behandeln. Was für viele nun wie ein Dammbruch wirkt, ist aber nur ein weiterer Schritt im Zuge des Aufstiegs einer neuen Schule von radikalen „Antirassisten“ in die Institutionen.
Für sie ist Deutschland bis ins Mark rassistisch – wie alle Länder, die mehrheitlich von weißen Menschen bewohnt werden. Wer das bestreitet, beweist damit in ihren Augen nur seinen Rassismus. Als Therapie verschreibt sie aktive Diskriminierung von Weißen und ein permanentes Bemühen, den Rassismus freizulegen, den sie in jedem Winkel der Gesellschaft und unserer Psyche vermutet.
Ursprünglich aus den Vereinigten Staaten stammend, nimmt der neue Antirassismus auch in Deutschland immer mehr Fahrt auf. Zum Beispiel am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DeZIM, das am 9. und 10. Juni auf einer Berliner Tagung die Auftaktstudie seines „Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors“ (NaDiRa) vorgestellt hat.
Den Auftrag zur Einrichtung des NaDiRa erhielt das Institut bereits 2020 vom Deutschen Bundestag auf Initiative des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus unter Angela Merkel. Offiziell soll der Rassismusmonitor kontinuierlich „Ursachen, Ausmaß und Folgen von Rassismus in Deutschland“ untersuchen und in regelmäßigen Abständen entsprechende Studien veröffentlichen.
Grenzen zwischen Wissenschaft und Aktivismus werden verwischt
Federführende Leiterin des DeZIM ist Naika Foroutan, Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Berliner Humboldt-Universität. Foroutan bezeichnet sich selbst als „partielle Aktivistin“. In einem Podcast Anfang des Jahres freute sie sich darüber, dass viele Akademiker wissenschaftliches und aktivistisches Handeln „nicht mehr so hart trennen“ würden.
Foroutan bekennt sich zur Identitätspolitik, jener aktivistischen Schule, die durch Mobilisierung von Gruppenidentitäten für Macht- und Verteilungskämpfe gerechtere Verhältnisse zu schaffen gedenkt. In einem Fragebogen der Frankfurter Rundschau riet sie 2018 der SPD, „die Klassenfrage mit der Gender- und Race-Frage zu verknüpfen“. Sie bezeichnet den Kommunismus als „Utopie, der es sich lohnt, weiter nachzugehen“.
Das DeZIM wird aus Mitteln des Bundesfamilienministeriums finanziert – desselben Hauses, das unter dem Stichwort „Demokratieförderung“ bereits seit Jahren diverse Aktivistengruppen mit Geld ausstattet und es für unzumutbar hält, von ihnen im Gegenzug ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu verlangen. Zuletzt haben die Ampel-Parteien die Förderung für das DeZIM im Rahmen des Bundeshaushalts 2022 noch einmal um 1,2 Millionen auf 4,8 Millionen Euro jährlich erhöht. Doch wie genau sieht die Rassismusforschung des DeZIM aus – und welche Lösungen bietet es an?
Ist Rassismus wirklich jederzeit und überall anzutreffen?
„Rassismus ist für eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland eine allgegenwärtige Erfahrung“, heißt es in der Auftaktstudie des Rassismusmonitors. Der Befund, dass in Deutschland auch heute noch Rassismus anzutreffen ist, überrascht nicht. Aber ist er „allgegenwärtig“? Stößt man hierzulande täglich auf Rassismus, wo man geht und steht?
Die Studie beruht auf einer repräsentativen Befragung von rund 5000 Personen. Von ihnen wollten die Autoren unter anderem wissen, ob sie schon einmal auf eine von drei möglichen Arten mit Rassismus in Berührung gekommen sind: Sie wurden selbst rassistisch behandelt (22,2 Prozent), sie haben rassistische Vorfälle beobachtet (45,1 Prozent) oder sie haben aus dem Bekanntenkreis von Rassismuserfahrungen gehört (48,8 Prozent).
Was für Vorfälle dies konkret waren und wie oft die Teilnehmer sie erlebt haben, wurde nicht erfragt. So ergeben sich nur zwei Kategorien: betroffen oder nicht betroffen. Es würde also genügen, ein einziges Mal im Leben einen rassistischen Vorfall unbekannter Schwere beobachtet zu haben, um als Rassismusbetroffener eingestuft zu werden, unabhängig davon, wie viele rassismusfreie Tage und Begegnungen man davor und danach auch erlebt haben mag. Aus der zahlenmäßigen Größe der so gebildeten Betroffenen-Kategorie wird dann abgeleitet, dass Rassismus „für eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland eine allgegenwärtige Erfahrung“ sei.
Ein rassifiziertes Weltbild
Diese Kategorienbildung zeigt eine Tendenz, die den ganzen Bericht prägt: Das Bestreben, die Gesellschaft möglichst umfassend des Rassismus zu überführen. Wo die Studie Positives über die Bevölkerung zu sagen hat, geht es immer auf die eine oder andere Art darum, dass ein Problembewusstsein für Rassismus vorhanden sei – nie darum, dass Rassismus nicht überall ein Problem sei, weniger ein Problem sei als früher oder gar, dass manche Menschen schlicht nicht rassistisch seien. Das große Bild, das die Studie zeichnet, ist das einer zutiefst rassistischen Gesellschaft, die über den eigenen Rassismus zugleich schwer besorgt ist.
Die Studie unterscheidet unter den Befragten sechs „rassifizierte Gruppen“: Schwarze, Juden, Muslime, Asiaten, Osteuropäer sowie Sinti und Roma. „Rassifiziert“ bedeutet, dass die Mehrheitsgesellschaft den Betroffenen die Zugehörigkeit zu einer imaginären „Rasse“ aufgedrückt habe, um ihre Ausbeutung und Unterdrückung zu rechtfertigen. Die siebte Gruppe sind also diejenigen, die das tun, die Rassifizierer; Atamans „Kartoffeln“.
Die „rassifizierten Gruppen“ werden auch als „potenziell von Rassismus Betroffene“ bezeichnet. Darin verbirgt sich das bekannte Mantra „Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße“, das sich durch eben diese Vorannahme begründet: Rassismus ist eine Ideologie, mit der eine Gruppe die Unterdrückung anderer Gruppen rechtfertigt. Mitglieder von Minderheiten können daher nicht rassistisch sein, während Mitglieder von Mehrheiten nicht Opfer von Rassismus sein können.
Zwei unvereinbare Rassismusbegriffe
Man kann über das Für und Wider dieser Definition streiten. Doch sie trägt ein doppeltes Kommunikationsproblem in die Studie hinein. Die Befragten verstehen womöglich etwas anderes unter „Rassismus“ als die Fragenden, ebenso wie die späteren Leser von Zeitungsmeldungen über die Ergebnisse. Gleichzeitig nehmen aber beide Gruppen treuherzig an, sie wüssten, worum es geht. Eine mögliche Folge dieser Begriffsverwirrung: Wenn befragte Juden beispielsweise über Rassismus berichtet hätten, der von Muslimen ausgeht, oder Sinti und Roma über solchen von Osteuropäern, bildet die Studie das nicht ab, denn sie lässt explizit nur den Rassismus der „nicht Rassifizierten“ als solchen gelten. Durch dieses theoretische Framing kann man als Leser nicht anders, als sämtlichen gemeldeten Rassismus den Deutschen ohne Migrationshintergrund zuzuschreiben.
Dass die Bevölkerung Rassismus anders wahrnimmt als die zugrunde gelegte Theorie, zeigt bereits der Befund, dass fast der gleiche Anteil der „Rassifizierten“ und der Übrigen die Frage bejaht, ob wir „in einer rassistischen Gesellschaft“ leben – 51 Prozent versus 49 Prozent. Wenn „Rassifizierte“ theoriegemäß unter allgegenwärtigem Rassismus litten, während die Rassifizierer aufgrund ihres Privilegs blind für diese Tatsache wären, müsste dieses Verhältnis anders aussehen.
Fangfragen als Forschungsmethode
Ist Rassismus etwas, das „in erster Linie bei Rechtsextremen“ vorkommt? Dem stimmen rund 60 Prozent der Befragten zu. Die Studie wertet dies als „Externalisierung“, eine Form von „Abwehrverhalten“. Die Annahme: Die Befragten sind selbst rassistisch, wollen das aber nicht wahrhaben und streifen das Problem daher auf die Rechtsextremen ab. Doch „in erster Linie“ bedeutet nicht „ausschließlich“. Die Aussage, dass Rassismus in erster Linie bei Rechtsextremen auftrete, ist geradezu per Definition richtig, da sich Rechtsextreme wesentlich durch ihren Rassismus vom Bevölkerungsdurchschnitt unterscheiden. Zudem leitet die Studie ihre Diskussion des Themas Rassismus selbst mit Verweisen auf rechtsextreme Morde ein. Offenbar denken also auch die Autoren bei diesem Thema „in erster Linie“ an Rechtsextremismus.
Diese – in Ermangelung eines besseren Wortes – böswillige Auslegung von erzwungenen Ja-oder-Nein-Antworten zieht sich wie ein roter Faden durch die Studie. Sie fragt etwa auch, ob es „verschiedene menschliche Rassen“ gebe, und wertet die rund 50 Prozent zustimmenden Antworten als Beleg für „rassistische Wissensbestände“, die „in der Bevölkerung tief verankert“ seien. Unklar bleibt aber, was sich die Befragten unter dem Begriff vorstellen – und wie man nach Meinung der Autoren die Tatsache begrifflich fassen soll, dass Menschen aus verschiedenen Erdteilen unterschiedlich aussehen. Die naheliegendste Annahme ist, dass die Befragten schlicht dies meinen, ohne damit konkrete Vorstellungen von biologischen Unterschieden oder gar einer Ungleichwertigkeit zu verbinden.
Ironischerweise handelte der Eröffnungsvortrag des Philosophen Daniel James auf der erwähnten Tagung zum Rassismusmonitor davon, welcher der Begriffe „Rasse“, „Race“ oder „rassifizierte Gruppe“ am besten geeignet sei, um über „Rasse“ zu sprechen. Ein wenig neidisch merkte James an, dass die Amerikaner mit dem Begriff „entspannter“ umgingen als die Deutschen.
Man braucht demnach den Ausdruck „Rasse“ oder einen geeigneten Ersatz, weil es unterschiedliche menschliche Abstammungslinien nun einmal gibt und sie bis auf Weiteres bedeutsam bleiben, da sie mit Aussehen, Herkunft, Kultur und Identitäten verflochten sind. Doch während die Forscher für sich selbst eine untadelige, politisch korrekte Sprachregelung finden, zwingen sie die Befragten in eine unbefriedigende Ja-oder-Nein-Alternative hinein und werten das, was wahrscheinlich bei den meisten nur die Benennung einer offensichtlichen Tatsache ist, als „rassistischen Wissensbestand“.
Dies geht so weit, dass auf der Tagung wie in der Studie verschiedentlich der Verdacht geäußert wird, dass Sprecher mit alternativen Ausdrücken wie „ethnische Gruppe“ und sogar „Kultur“ oder „Religion“ eigentlich doch wieder nur „Rasse“ meinten und so ihre „rassistischen Wissensbestände“ offenbarten.
Was unerwähnt bleibt
Aufschlussreich ist auch, was die Studie nicht erwähnt. Sie unternimmt keinen Versuch, den Rassismus in Deutschland in historischer oder globaler Hinsicht einzuordnen. Gibt es viel oder wenig davon? Welche Trends sind zu erkennen? Es fehlt jeder Vergleichsmaßstab.
Der „World Values Survey“, eine regelmäßige internationale Befragung zu Wertvorstellungen, zeichnet zumindest ein ungefähres Bild davon, in welchem Umfang rassistische Einstellungen in verschiedenen Ländern vorherrschen. Wie viele Menschen antworten auf die Frage, wen sie nicht als Nachbarn haben wollen – Gauland lässt grüßen –, „Leute einer anderen Rasse“?
Für das Jahr 2020 sind Daten aus 77 Ländern vorhanden. Die Liste wird angeführt von Burma (70 Prozent), Vietnam (62 Prozent), Macau (43 Prozent), der Türkei (41 Prozent) und dem Libanon (36 Prozent). Die drei am wenigsten rassistischen Länder sind nach diesem Indikator Island (1,7 Prozent), Brasilien (1,4 Prozent) und Schweden (1,0 Prozent). In Deutschland geben 3,7 Prozent diese Antwort, in den USA sind es drei Prozent. Im Jahr 1984, aus dem erstmals Daten vorliegen, waren es in Deutschland noch elf und in den USA acht Prozent.
Diese Antworten sind nur ein grobes Maß, doch man kann nicht grundsätzlich bestreiten, dass rassistische Einstellungen in westlichen Ländern seit der Mitte des 20. Jahrhunderts stark zurückgegangen sind. Und dafür müssten sich Rassismusexperten doch eigentlich stark interessieren, wenn ein weiterer Rückgang ihr Ziel ist. Denn wenn man weiß, welche Umstände den Abwärtstrend bewirkt und ermöglicht haben, kann man sich bemühen, sie zu pflegen.
Die erstaunlichste Lücke
Die Kernthese des Ganzen ist, dass die eigentliche soziale Funktion von Rassismus darin bestehe, soziale Ungleichheit zu schaffen und zu legitimieren. Vor diesem Hintergrund würde es naheliegen, zunächst einmal eine Bestandsaufnahme der sozialen Ungleichheit durchzuführen. Im nächsten Schritt könnte man dann analysieren, zu welchem Anteil sie sich auf Rassismus zurückführen lässt, und nach Möglichkeiten suchen, benachteiligten Gruppen zu helfen.
Die Commission on Race and Ethnic Disparities, von der britischen Regierung im Jahr 2020 eingesetzt, hat diesen Weg beschritten. Die elf Kommissionsmitglieder, zehn davon „People of Color“, nahmen eine umfassende Analyse des vorhandenen Datenmaterials vor, um die soziale Ungleichheit im Vereinigten Königreich auszuloten und nach Ursachen und Lösungen zu suchen.
Ergebnis war unter anderem, dass Rassismus durchaus vorhanden sei, aber als Ursache von Ungleichheit heute nur eine untergeordnete Rolle spiele. Das zeige sich unter anderem darin, dass verschiedene Einwanderergruppen in höchst unterschiedlichem Maß erfolgreich seien, während auf der anderen Seite auch Teile der angestammten weißen Bevölkerung in Armut lebten. Die Kommission identifizierte unter anderem Familienverhältnisse als entscheidenden Faktor des späteren Lebenserfolges oder ‑misserfolges und schlug eine Reihe praktischer, evidenzbasierter Maßnahmen gegen Ungleichbehandlung und zur Förderung benachteiligter Gruppen vor.
Die Erwählten
Der Rassismusmonitor dagegen belässt es bei allgemeinen Verweisen auf Ungleichheit und verzichtet darauf, sie näher zu untersuchen. Wie kann das sein, wenn Ungleichheit das Problem ist, um das es letztlich geht?
Eine mögliche Erklärung findet sich in dem aktuellen Buch „Die Erwählten: Wie der neue Antirassismus die Gesellschaft spaltet“ des afroamerikanischen Linguistik-Professors John McWhorter. Seine These: Der Antirassismus der dritten Welle, der maßgeblich von der sogenannten Critical Race Theory inspiriert ist und seit etwa 2010 rasant an gesellschaftlichem Einfluss gewinnt, ist im Kern weder Wissenschaft noch Politik, sondern Religion. Zentraler Glaube dieser Religion ist, dass weiße Menschen und ihre Gesellschaften zutiefst rassistisch seien – das ist die Erbsünde –, und ihre religiöse Praxis besteht darin, dies überall zu erkennen, sichtbar zu machen und anzuprangern – auch wenn wir uns letztlich nie ganz von der Sünde reinwaschen können.
Immunisierung gegen Kritik
Religiöses Denken zeigt sich recht deutlich in der oben erwähnten Diagnose „Abwehrverhalten“, der die Studie ein ganzes Kapitel widmet. Damit wird jeder Widerspruch gegen das Vorgetragene als ungültig und unmoralisch abgestempelt. Das Konzept entspricht etwa dem der „weißen Fragilität“, das die Pädagogin Robin DiAngelo in ihrem Bestseller „White Fragility“ ausführt. Im Kern: Wenn Weiße abstreiten, rassistisch zu sein, beweist das nur, dass sie rassistisch sind.
Eine solche dogmatische Gewissheit, die sich über gegenläufige empirische Befunde hinwegsetzt und mit der vollen Wucht moralischer Verurteilung verteidigt wird, ist ein Bruch mit allem, was Wissenschaft und eine aufgeklärte Gesellschaft ausmacht. Ebenso hat die Annahme nichts mit wissenschaftlichem Wissen zu tun, dass sich beispielsweise Armut unter ethnischen Minderheiten am besten bekämpfen lasse, indem sich die Weißen im betreffenden Land obsessiv mit dem eigenen Rassismus befassen. Sie ist ein Glaube. Ein entsprechender Wirkmechanismus ist weder bekannt, noch wird er überhaupt ernsthaft gesucht.
Die Forschung zu Diversity-Schulungen, die man als Anhaltspunkt nehmen könnte, zeigt desaströse Ergebnisse. Sie bringen vielen Studien zufolge gar nichts oder wirken durch eine Reihe unerwünschter psychologischer Effekte sogar negativ. Sie erzeugen Trotz, verstärken essenzialistisches Denken, setzen Stereotype erst in die Köpfe hinein oder lehren Minderheiten geradezu, ihr soziales Umfeld als feindselig wahrzunehmen.
Ergebnisgleichheit als Maßstab
Für die neuen Antirassisten ist jede Ungleichheit zwischen ethnischen Gruppen rassistisch und ungerecht. Dies erklärte etwa Merih Ates, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Rassismusmonitors, in seiner Anmoderation des Panels zur Studie.
Doch wenn Menschen als Hilfsarbeiter oder sogar Flüchtlinge in ein Land kommen, vielfach die Landessprache nicht sprechen, sich nicht auskennen, keine Kontakte haben und keine kompatible Ausbildung mitbringen – bedarf es dann einer besonderen Erklärung, dass diese Zugewanderten im Durchschnitt weniger verdienen als Menschen, die im Land aufgewachsen sind, dessen Sprache sprechen und sein Bildungssystem durchlaufen haben? Wie könnte es anders sein? Wie kann es nichts mit den Minderheitengruppen selbst zu tun haben, dass manche von ihnen im Durchschnitt mehr und andere weniger verdienen als die „nicht von Rassismus Betroffenen“? Und was für eine Politik soll imstande sein, diese Ungleichheit aufzuheben?
Ibram X. Kendi, US-Bestsellerautor und prominente populistische Stimme des neuen Antirassismus, hat darauf eine Antwort. Auch für ihn ist jede Ungleichheit zwischen ethnischen Gruppen Rassismus. 2019 forderte er daher die Schaffung eines Verfassungszusatzes, der bestimmen sollte, dass ethnische Ungleichheit als Beweis für rassistische Politik zu gelten habe. Weiter forderte er die Einrichtung eines Ministeriums für Antirassismus, besetzt mit Rassismusexperten, die ein Vetorecht für alle politischen Entscheidungen sowie die Befugnis haben sollten, „Disziplinarmaßnahmen“ über Behördenvertreter zu verhängen, die „ihre rassistischen Politikkonzepte und Vorstellungen nicht freiwillig verändern“. Das wäre eine Diktatur.
Antirassismus als Vorstufe zum Kommunismus
Doris Liebscher, Leiterin der Ombudsstelle der Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung, äußerte in ihrem Vortrag auf der Tagung einen Wunsch: Das Bundesverfassungsgericht möge in den nächsten Jahren entscheiden, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gebe. Damit, so Liebscher, wären dann Quoten für „migrantifizierte und rassifizierte Menschen“ nicht nur möglich, sondern verfassungsrechtlich geboten. Auch dafür hat Kendi eine griffige Formel: „Das einzige Mittel gegen rassistische Diskriminierung ist antirassistische Diskriminierung.“
Doch allein mit Quoten ist weder die soziale Ungleichheit noch der alles durchdringende Rassismus überwunden. Sie könnten daher nur ein bescheidener Anfang sein. Cihan Sinanoğlu, Leiter des Rassismusmonitors, bringt auf Twitter regelmäßig zum Ausdruck, wie er Deutschland und Europa verabscheut, was wiederum die Tiefe der Veränderungen erahnen lässt, die er für nötig hält.
Der Bruch
Nach Ibram X. Kendi muss ein Antirassist auch Antikapitalist sein. Sinanoğlu wird dem nicht widersprechen. Am 14. Mai bemerkte er: „Kapitalismus und Rassismus sind untrennbar miteinander verwoben.“ Am 31. Mai: „Die Arbeiter*innen verdienen nicht mehr ‚Fairness‘ oder ‚Anerkennung‘. Sie verdienen vor allem ein Leben frei von Ausbeutung und Entfremdung. Diese sind konstitutiv für kapitalistische Gesellschaften und lassen sich nicht mit ‚Diversity-Kursen‘ abschaffen.“
Anfang Juni teilte er auf Twitter das Programm der Konferenz „Socialism 2022 – Change Everything“ und kurz darauf einen Tweet von Bini Adamczak, Autorin diverser Bücher über Kommunismus und Revolutionen: „Der Kommunismus existiert nicht im Singular. Das Gemeinsame meint keine Einheit, die alles umschließt, indem sie es einer Idee, einem Willen, einer Zentrale unterordnet. Das Gemeinsame ist vielmehr das, was die Vielen miteinander teilen. Als Gleiche und Freie in Solidarität.“ Ein paar Tage später erklärte er: „Manche politischen Verhältnisse, aber auch persönliche Beziehungen, lassen sich nicht versöhnen. Der Bruch ist die einzige Möglichkeit, Neues zu denken und sich neu in Beziehung zur Welt zu setzen.“
Als das DeZIM am 20. Mai auf Facebook die Erhöhung seiner Fördersumme verkündete, wandte es sich auch an die Ampel-Parteien: „Wir danken Bruno Hönel und der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Elisabeth Kaiser und der SPD-Bundestagsfraktion sowie Claudia Raffelhüschen und der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag herzlich für ihren Einsatz!“