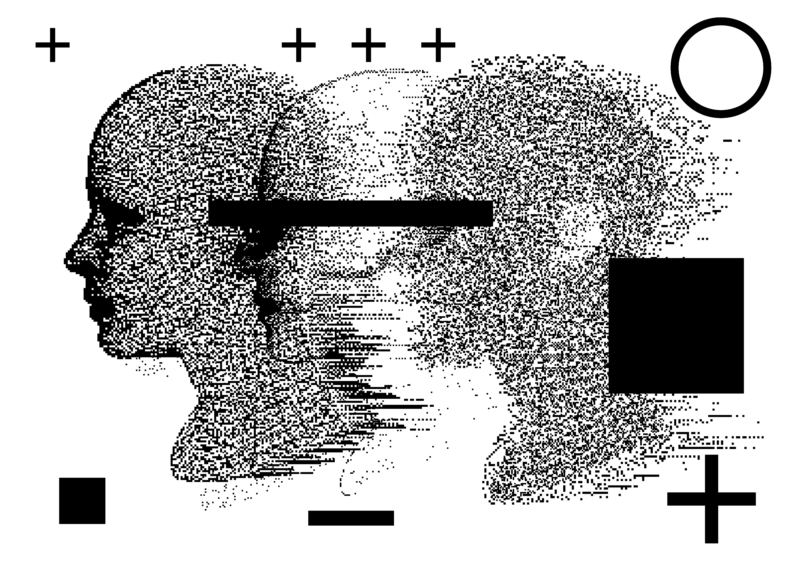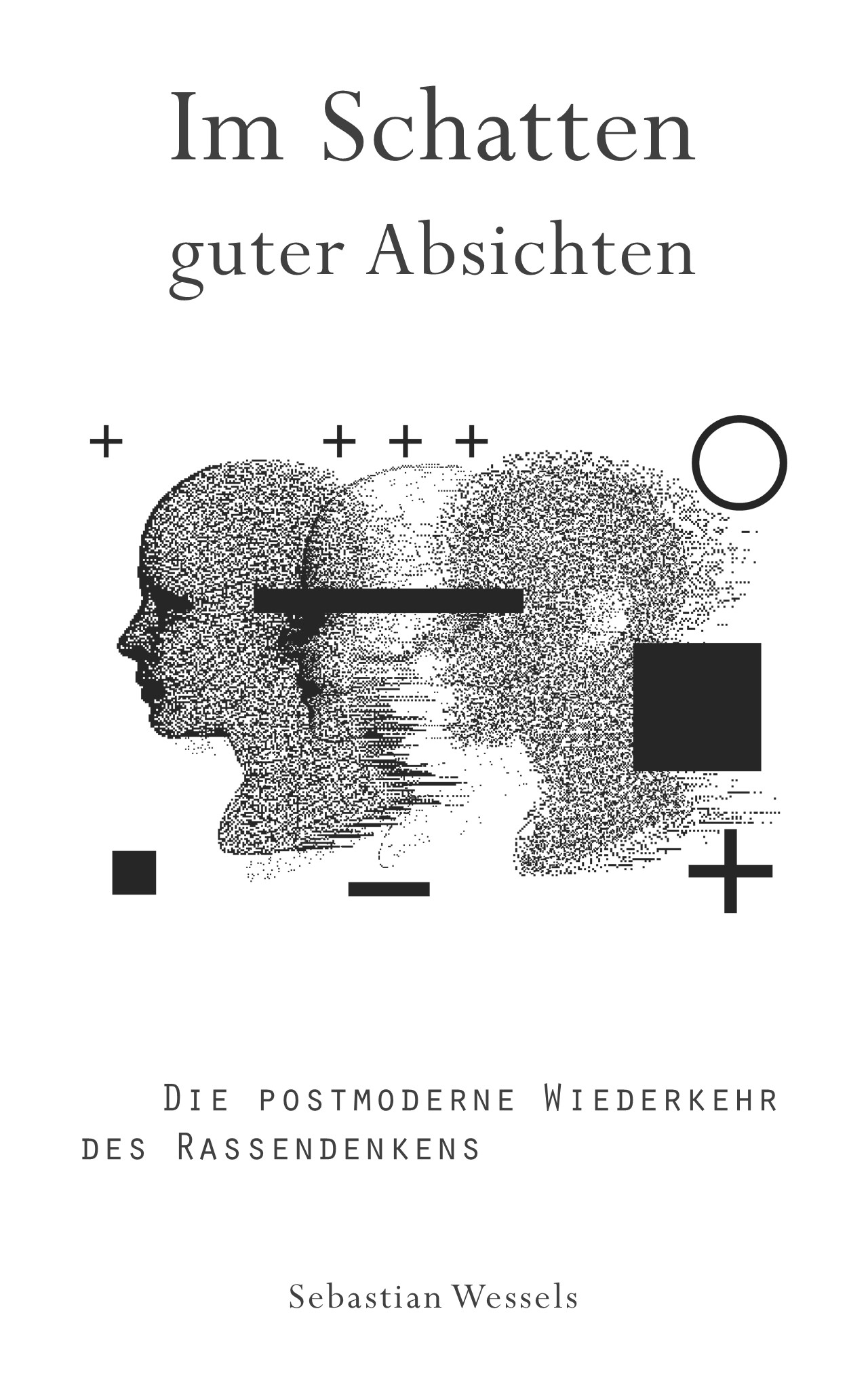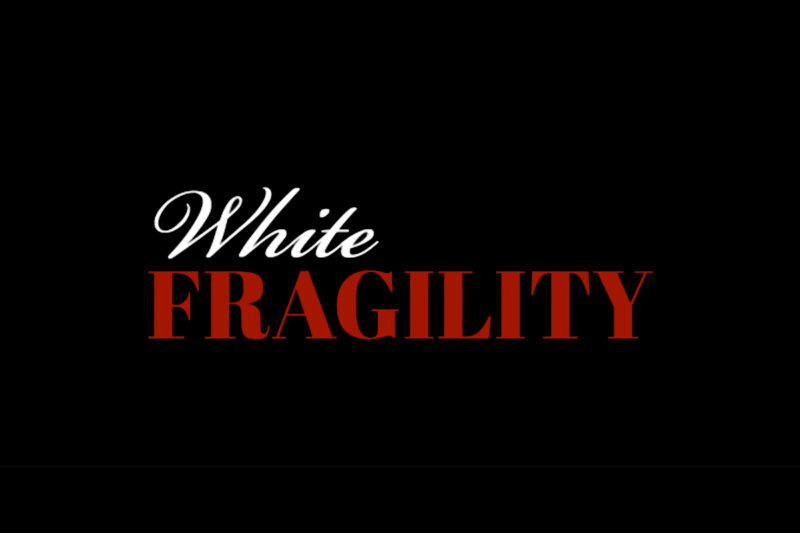Ein zentraler Mechanismus der Wokeness-Ideologie beruht auf dem strategischen Einsatz von Begriffen mit doppelten Bedeutungen. Alle ihre tragenden Begriffe treten in mehreren Bedeutungsvarianten auf, die von unterschiedlicher theoretischer (bzw. theologischer) Tiefe und in unterschiedlichen Phasen der Indoktrinierung anschlussfähig sind. Die mehr oberflächlichen, naiven Bedeutungen sind ansprechend für Neulinge und anschlussfähig an den Liberalismus; die tieferen bilden die Gedankenwelt der fortgeschrittenen Ideologen, die sich von derjenigen normaler Menschen im Liberalismus drastisch unterscheidet. Die Doppelbegriffe tarnen diese Realitätsferne der Theorie und Forderungen und verkleiden sie zunächst als etwas Harmloses. Je tiefer man dann in die Theorie und zugehörigen Kreise eintaucht, desto mehr wird man mit den weniger harmlosen Gehalten vertraut. Dieser Mechanismus ist für das Verständnis der »Social Justice«-Ideologien und der Mechanismen ihrer Verbreitung wesentlich.
→ weiterlesen»Du darfst nur nicht mitspielen«
Beim Kampf gegen Rassismus geht es doch verdammt noch mal nicht um die Befindlichkeiten und Bedürfnisse und Empfindlichkeiten von weißen Menschen.
Nach klassischer Definition und allgemeinem Sprachgebrauch ist Rassismus eine meist abwertende Beurteilung von Personen auf Basis tatsächlicher oder zugeschriebener rassischer Eigenschaften beziehungsweise die Ungleichbehandlung, die aus solchen Beurteilungen erwächst. Doch diese Auffassung wird mehr und mehr durch eine neue abgelöst, der zufolge man nur dann von Rassismus sprechen könne, wenn die Abgewerteten »strukturell benachteiligt« (o. Ä.) und die Rassisten »strukturell privilegiert« sind, und die strukturell Privilegierten seien in unserer Welt immer die Weißen.
Natürlich können sich Begriffsbedeutungen wandeln und kann man Definitionen ändern. Das ist aber nur dann sinnvoll und wird ohne Gewaltakt wohl auch nur dann gelingen, wenn dadurch die Ausdrucks- und Differenzierungsmöglichkeiten der Sprache zunehmen oder wenigstens gleichbleiben. Das ist hier nicht der Fall. Die Ausdrucks- und Differenzierungsmöglichkeiten des neuen Rassismusbegriffs sind um Größenordnungen geringer als die des klassischen, wie ich im Folgenden erläutere.
→ weiterlesenMein Buch über Wokeness und sogenannten Antirassismus
(Aktualisiert am 7. Mai 2023)
Ich habe eine leicht überarbeitete Fassung des Artikels Der rassistische Antirassismus – Kritik einer Massenhysterie zusammen mit ein paar neueren Texten zum Thema als Buch veröffentlicht. So sieht es aus:

Und hier ist es käuflich zu erwerben. In einem kleinen Taschenbuchformat umfasst es 224 Seiten. Der Einfachheit halber gebe ich unten das Vorwort wieder, um es vorzustellen.
Vorab ein paar Leserstimmen aus den Rezensionen:
Das Buch von Sebastian Wessels hat mich positiv überrascht, und ich würde sagen, dass es das beste seiner Art zu diesem Thema (die „Critical Race Theory“) ist, das ich bislang gelesen habe.
Die zerstörerische Tendenz der mit schön klingenden Schlagworten wie »inklusiv«, »antirassistisch« usw. bemäntelten, pseudokritischen Theorien dürfte dem interessierten Beobachter aktueller US-amerikanischer Diskurse bekannt sein. Dieses Buch bietet ihm eine auf den Punkt gebrachte Zusammenfassung der Thematik und wertvolle Quellen.
Das Buch »Im Schatten guter Absichten« von Sebastian Wessels ist ein Meilenstein, wenn es um das Verstehen und Begreifen der sogenannten »Kritischen Sozialen Gerechtigkeit« geht.
Sebastian Wessels ist ein ausgezeichnetes Buch gelungen, in dem er durchgehend klug argumentiert und zeigt, warum eine aktuell starke Variante vermeintlichen »Antirassismus« in Wahrheit Aufwind für Rassisten von links und rechts bedeutet.
Ein mutiges und wichtiges Buch!
Hier außerdem ein kurzes Interview und hier eine weitere Rezension. Das Vorwort und das erste Essay des Buches gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal zum Anhören.
→ weiterlesenMulholland Drive und die Blindheit der festgelegten Wahrnehmung
Zum ersten Mal sah ich David Lynchs Mulholland Drive vor bald 20 Jahren zusammen mit ein paar Freunden im Kino. Wir fanden den Film interessant, witzig und irgendwie hypnotisch, aber wir verstanden ihn nicht. Ich war bereit, mich einfach damit abzufinden. Einer meiner Freunde aber googelte in den nächsten Tagen herum und fand eine Interpretation, die zumindest den Großteil des Rätsels löste. Zuerst war ich misstrauisch. Das Ego hört nicht gern Lösungen für Probleme, die es selbst für unlösbar erklärt hatte. Aber es passte alles so gut zusammen, dass ich mich nicht lange dagegen wehren konnte, es zu akzeptieren. Nun begann ich mich zu fragen, warum ich nicht selbst darauf gekommen war. Wir beschlossen, den Kinobesuch zu wiederholen, und sahen nun tatsächlich alles in einem neuen Licht, so dass es endlich Sinn ergab. Danach stellte sich mir noch dringender die Frage, warum ich nicht selbst darauf gekommen war, denn es schien auf der Hand zu liegen.
→ weiterlesen5 Gründe, warum das Buch »Wir müssen über Rassismus sprechen« seicht und destruktiv ist
Unter dem Titel »Wir müssen über Rassismus sprechen« erschien soeben die deutsche Fassung des Buches »White Fragility« von Robin DiAngelo, das in den USA ein Bestseller und wesentlich für die Popularisierung der »Critical Race Theory« verantwortlich ist. Mit freundlicher Genehmigung veröffentliche ich aus diesem Anlass folgende Übersetzung eines kritischen Beitrags von Anne Bailey, der zuerst auf Medium und dann auf New Discourses erschien.
Zu den Büchern, die heute häufig als Pflichtlektüre gehandelt werden, gehört Wir müssen über Rassismus sprechen von Robin DiAngelo. Darin möchte DiAngelo weiße Menschen lehren, wie sie den eigenen Rassismus identifizieren können und auf welch vielfältige Weise sie sich dagegen sträuben, ihn anzuerkennen. Ihre These lautet im Wesentlichen, dass weiße Menschen es nicht akzeptieren können, des Rassismus beschuldigt zu werden, und aufgrund dieser »Fragilität« mit emotionaler Abwehr reagieren. Um die systemische weiße Vorherrschaft niederzureißen, müssten alle Weißen den eigenen Rassismus anerkennen.
Anstatt ein ehrliches Gespräch über Rassismus zu führen, hat DiAngelo einen neuen Rahmen für die Definition von Rassismus und weißer Vorherrschaft erfunden. Dieser Rahmen ist nicht nur unlogisch; er ist toxisch, seicht und destruktiv. Hier sind fünf Gründe, warum das Buch Wir müssen über Rassismus sprechen nicht ernst genommen werden sollte.
→ weiterlesenDer rassistische Antirassismus – Kritik einer Massenhysterie
Update Januar 2021: Inzwischen ist eine leicht überarbeitete Fassung dieses Beitrags zusammen mit neuen Texten zum Thema als Buch und E‑Book erschienen.
Viele von Ihnen werden auf das, was ich zu sagen habe, eine negative Reaktion im Bauch verspüren. Ihnen wird nicht gefallen, wie es klingt. Insbesondere wird Ihnen nicht gefallen, wie es klingt, wenn es von einem Weißen kommt. Dieses Gefühl der Ablehnung, dieses Gefühl der Empörung, dieses Gefühl des Ekels, dieses Gefühl von »Sam, was zum Teufel ist dein Problem? Warum redest du überhaupt über das Thema?« – dieses Gefühl ist kein Argument. Es ist keine Basis, oder sollte keine sein, um irgendeine Aussage über die Welt für wahr oder falsch zu halten. Ihre Fähigkeit, empört zu sein, ist nichts, was ich oder sonst jemand respektieren müsste. Ihre Fähigkeit, empört zu sein, ist nicht einmal etwas, das Sie respektieren sollten. Tatsächlich ist sie etwas, wovor Sie auf der Hut sein sollten, vielleicht mehr als vor jeder anderen Eigenschaft Ihres Geistes.
Sam Harris
Wir sehen zur Zeit wieder »zwei Filme auf einer Leinwand« (Scott Adams). Verschiedene Teile der Gesellschaft starren auf dieselben Ereignisse und sehen völlig unterschiedliche Dinge, und das glasklar. Vielen ist die Sichtweise der anderen nicht nur unverständlich, sondern unerträglich.
Die vielleicht beste Veranschaulichung dafür sind die verschiedenen Bedeutungen, die ein Satz wie »all lives matter« oder gar »white lives matter« annehmen kann. Für die einen sind das Selbstverständlichkeiten eines egalitären Humanismus, für die anderen rassistische Kampfparolen.
Dieser unchristlich lange Beitrag ist ein Versuch, den allgemeinen Aufruhr nach dem Tod von George Floyd zu interpretieren und in die kulturelle Landschaft der Gegenwart einzuordnen. Er gliedert sich grob in drei Hauptteile und ‑thesen:
1.) Das Ausbleiben der Gegenprobe – Antirassismus als Religion
In den Massenprotesten und der medialen Begleitmusik drückt sich ein religiöses Bedürfnis aus. Dies macht den Beteiligten rationale Recherche und Reflexion weitgehend unmöglich. Stattdessen bestimmt religiöser Furor das Bild. Das zugrundeliegende religiöse Bedürfnis muss man als tieferliegendes gesellschaftliches Problem ernstnehmen.
2.) Im Schatten guter Absichten
In den Massenprotesten und der medialen Begleitmusik gehen destruktive Bestrebungen eine Verbindung mit guten Absichten ein. Einzelne Teilnehmergruppen sind mehr von den einen, andere mehr von den anderen beseelt, und die destruktiven können leicht mit den guten Absichten verkleidet und verwechselt werden. Aufgrund der religiösen Aufladung des Themas sind die Massenmedien weitestgehend unfähig oder nicht willens, sich diesem Problem zu stellen.
3.) Wie der postmoderne Antirassismus spaltet und Rassismus fördert
Soweit der tonangebende Antirassismus postmodernistisch verfasst ist (»Critical Race Theory«), reduziert er Rassismus und ethnisch-kulturelle Konflikte nicht, sondern vermehrt sie, indem er 1. eine wesensmäßige und bis auf Weiteres unüberbrückbare Verschiedenheit und Trennung zwischen Weißen und Nichtweißen postuliert (woran es praktisch nichts ändert, dass er diese als »sozial konstruiert« ausgibt), 2. Weiße pauschal verurteilt und anfeindet, was selbst rassistisch ist und Trotz hervorrufen muss, umso mehr, da er zugleich explizit anstrebt, dass die Weißen sich ihres Weißseins stärker bewusst werden, und 3. Nichtweiße tendenziell entmündigt, indem er sie als den Weißen unterlegen und ihrer Fürsorge bedürftig charakterisiert. Zugrunde liegt dem eine aggressive politischen Variante des Postmodernismus, die den radikalen Zweifel der Vorväter ins Gegenteil verkehrt hat: sektiererische Gewissheit über die Richtigkeit des eigenen Weltbildes.
→ weiterlesenEin aufgepeitschter See
Hauptsächlich habe ich deshalb eines Nachts angefangen, ein paar Gedanken über die Coronasituation aufzuschreiben, weil Sorge und Angst mich am Einschlafen hinderten und es meist etwas Ruhe bringt, so etwas zu artikulieren. Nicht deshalb, weil ich ein besonderes Wissen oder Verständnis beizutragen hätte. Ich habe keine Ahnung. Doch wir alle müssen uns ja darüber Rechenschaft geben, was unserer Meinung nach passiert, auch ohne Ahnung zu haben. Es gehört zum Wesen der Situation, keine Ahnung zu haben. Doch wer zur Angst neigt und keine unerfreulichen Bilder im Kopf haben will, lässt diesen Text vielleicht besser aus. Er verpasst nichts Wichtiges.
→ weiterlesenNach Hanau (II.) – die Abschaffung des Konservatismus
Die dominante Reaktion auf Hanau ist die Forderung und Ankündigung, den »Kampf gegen rechts« zu verschärfen. Das ist gut und richtig, wenn es bedeutet, Terror und Gewalt mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu verhindern und extremistische Bestrebungen so klein zu halten wie möglich. Doch sind die Strategien, die üblicherweise unter »Kampf gegen rechts« laufen, dazu geeignet, diese Anliegen voranzubringen? Sind wir sicher, dass sie mehr nützen als schaden? Ich bezweifle das und habe eher den Eindruck, dass sie zu großen Teilen nutzlos oder kontraproduktiv sind.
Die grobe Linie dieser Verschärfungsstrategie ist, den Spielraum für Diskussionen über Migration, Integration und Multikulturalismus weiter einzuengen, dem Bevölkerungsanteil rechts der Mitte mit neuer Entschiedenheit die demokratische Partizipation zu verweigern und noch nachdrücklicher die Durchsetzung progressiver Gesellschaftsideale zu betreiben.
→ weiterlesenNach Hanau (I.) – Zwei Filme auf einer Leinwand
Die Schreckenstat von Hanau hat den Riss durch die Bevölkerung vertieft, den Hass der Ränder aufeinander verstärkt und uns alle noch einmal nervöser gemacht. Wie bei jedem Amoklauf liegt die größte Tragik in der sinnlosen Brachialgewalt, die scheinbar aus dem Nichts heraus in das Alltagsleben Unschuldiger hereinbricht und sie in den Tod reißt. Zuerst gilt es dann um die Opfer zu trauern, die Hinterbliebenen gut zu versorgen und sich auf Achtsamkeit zu besinnen – nicht im Sinne von Überwachung, sondern im Sinne gelebter Mitmenschlichkeit im Alltag. Soziale Kälte, Isolation und Ignoranz machen solche Taten möglich. Eine deutliche Regelmäßigkeit bei Amokläufen ist, dass sie sich ankündigen. Die Bereitschaft zu einer solchen Tat ist nicht einfach da, sondern entwickelt sich über einen langen Zeitraum. Meistens kommunizieren die späteren Täter mehrfach, dass sie auf einem dunklen Weg sind. Es gibt keine einfachen Antworten, aber das Wegsehen anderer gehört auffallend oft zu den Voraussetzungen solcher Taten.
Es ist allerdings auch unvermeidlich und notwendig, nach den größeren politischen Implikationen außeralltäglicher Gewaltausbrüche zu fragen. Die Opfer ernstzunehmen heißt auch, zu versuchen, ähnliche Gewaltausbrüche in Zukunft nach Möglichkeit zu verhindern. Es ist also nicht falsch, nach der politischen Bedeutung von Hanau zu fragen. Dennoch ist es tragisch, wie sehr hierbei alles dem vorhersehbaren Muster folgt. Die Tragik der unmittelbaren Destruktivität der Tat kann sich noch vervielfachen, wenn diese gesellschaftliche Entwicklungen anstößt oder verschärft, die weitere blutige »Verwerfungen« (Y. Mounk) wahrscheinlicher machen, bis hin zur Destabilisierung des gesamten Systems. Es ist im Kern die Tragik von Blutfehden, bei denen Menschen auf Leid und Tod mit der Schaffung von immer mehr Leid und Tod reagieren, hier allerdings in höherer Größenordnung und auf höherem Komplexitätsniveau.
Es war absehbar, dass es irgendwann wieder eine rechte Gewalttat geben würde, ebenso wie absehbar war und ist, dass es irgendwann wieder eine islamistische oder anderweitig auffällige Gewalttat von Zuwanderern geben würde. Dies ist im Sinn des oben Gesagten kein Kleinreden, sondern ein Hinweis auf die wichtige Überlegung, was wir tun können, damit sich in Folge solcher Gewalttaten nicht immer mehr gesellschaftliche Destruktivkräfte aufstauen. Den bereits identifizierten Feind noch heftiger bekämpfen zu wollen ist emotional naheliegend und nachvollziehbar, aber ob es dem sozialen Frieden dient, ist fraglich. Wenn man ihn nicht in absehbarer Zeit besiegen kann, bedeutet das Vorhaben zunächst nur einen längeren und intensivierten Krieg.
→ weiterlesenIst links gut und rechts böse?
Darf man mit rechten Parteien kooperieren? Darf man mit linken Parteien kooperieren? Muss man, wenn man das eine ausschließt, auch das andere ausschließen?
Anlässlich der Thüringer Krise der letzten Tage sind diese Fragen gerade wieder Gegenstand öffentlicher Diskussion. Zugrunde liegt ihnen die allgemeinere Frage, ob und inwiefern rechter und linker Radikalismus gleichwertig bzw. gleichermaßen verurteilungswürdig und gefährlich sind.
Die Annahme, dass sie das seien, kollidiert aufs Heftigste mit dem linken Selbstverständnis. Die Linke sieht sich als Kraft, die das Gute will und einer rechten Kraft gegenübersteht, die das Böse will.
Das Argument klingt etwa so:
Wie sollen rechts und links äquivalent sein? Linke stehen für Gleichheit. Sie setzen sich für die Schwachen ein und wollen mehr Gerechtigkeit schaffen. Rechte stehen für Ungleichheit. Sie wollen Menschen die Rechte wegnehmen, sie verfolgen und ausgrenzen. Das eine ist menschenfreundlich, das andere menschenfeindlich. Häufig wird »rechts« auch geradeheraus mit »Hass« gleichgesetzt.
Wenn man es so formuliert, kann man nur auf Seiten der Linken stehen. Dann sind diese unzweideutig die Guten und die Rechten die Bösen.
Doch das sagt zunächst einmal wenig aus, da es sich dabei um eine linke Selbstwahrnehmung und ‑beschreibung handelt. Wenn man einen Linken fragt, wofür die Linke steht, bekommt man wenig überraschend eine Antwort, die gut klingt. Wenn man einen Rechten fragte, wofür er steht, würde er ebenfalls kaum Ungleichheit, Ausgrenzung, Verfolgung und Hass sagen, sondern ebenfalls etwas, das gut klingt. Und er hätte auch eine weniger schmeichelhafte Beschreibung der linken Gegenseite parat, so dass ein unbedarfter außerirdischer Zuhörer zu dem Schluss käme, dass die Rechten wohl die Guten seien.
→ weiterlesen