Das Model auf der Titelseite des aktuellen Playboy, Hanna Sökeland, ist lesbisch und hat Kindheitserinnerungen, wie man sie von vielen Lesben, unter umgekehrten Vorzeichen von Schwulen und in geringerem Umfang auch von Heterosexuellen gelegentlich hören kann. Sie war als Kind kein typisches Mädchen:
Als kleines Kind habe ich eher maskulin gewirkt und mich oft wie ein Junge gekleidet. Die feminine Seite habe ich erst spät an mir entdeckt. Als meine jüngeren Schwestern angefangen haben, sich zu schminken, fand ich das irgendwie schön und wollte das auch machen. Heute mag ich beide Seiten total gerne an mir und wollte die neu entdeckte möglichst weit ausreizen.
Kein Problem, sollte man meinen. Aber dank Genderideologie und dahinter Queer Theory wird es heute für viele zum Problem.
Sökeland hat Glück, dass sie Mitte der 90er geboren wurde und nicht 20 Jahre später. Heute wird ein maskulin wirkendes Mädchen schnell für »trans« erklärt.
»Gender Affirmative Health Care«
Viele Mainstream-Informierte würden jetzt wahrscheinlich denken, ich sei verrückt oder wolle mit Desinformation aufhetzen. Aber es ist wirklich so. Und es ist unfassbar. Wahrscheinlich kommt es denjenigen, die das betreiben, sogar zugute, dass es so unfassbar ist, weil es deswegen eben auch schwer zu glauben ist und die meisten Menschen aufgrund ihres Vertrauens in Experten und Institutionen nie auch nur in Betracht ziehen würden, dass etwas so Wahnsinniges unter ihrer Ägide abläuft.

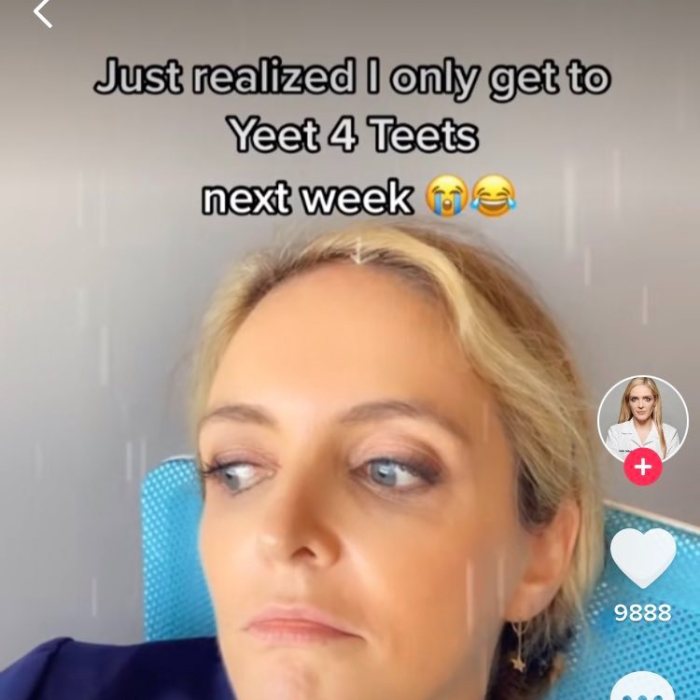
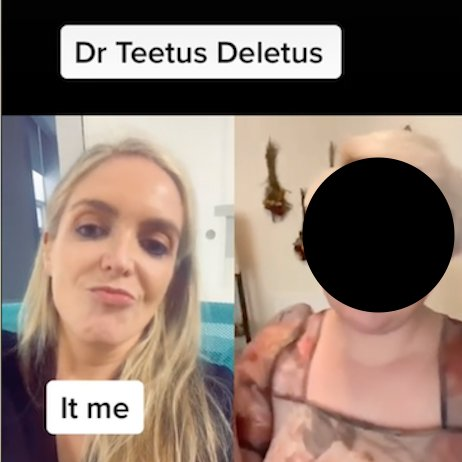

Wir haben einen explosionsartigen Anstieg der Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich als »trans« identifizieren. Die meisten davon sind Mädchen. Früher, bevor dieser Trend einsetzte, waren Transsexuelle überwiegend erwachsene Männer, die sich als Frau fühlten. Helen Joye schreibt in ihrem Buch »Trans«:
Im Jahr 1989, als die Tavistock-Klinik eröffnete, wurden zwei Personen mit Geschlechtsdysphorie eingewiesen, beides Jungen. 2020 waren es 2.378 Einweisungen, fast drei Viertel davon Mädchen und die meisten Teenager.
2019 schrieb der Spiegel zu einem Interview mit dem Kinderpsychiater Alexander Korte:
Wie viele transsexuelle Jungen und Mädchen in Deutschland leben, weiß niemand genau. In München jedenfalls hat sich die Zahl der Diagnose »Genderdysphorie« seit 2013 verfünffacht. In den USA halten sich laut der University of California in Los Angeles etwa 150.000 Teenager im Alter von 13 bis 17 für transgender. Präzise Zahlen gibt es aus Großbritannien. Dort baten vor neun Jahren 97 Kinder und Jugendliche den Gender Identity Development Service um Hilfe, das ist die nationale Anlaufstelle für Transkinder. Im Zeitraum 2017/18 meldeten sich 2519. Auch die Zahl geschlechtsangleichender Behandlungen ist deutlich gestiegen, etwa an der Laurels Clinic in Exeter – in neun Jahren von 21 auf 867. Auf der Warteliste standen zuletzt 988 Patienten.
Sibylle Winter, Leiterin der interdisziplinären Sprechstunde für Fragen der Geschlechtsidentität im Kindes- und Jugendalter an der Berliner Charité, neulich in der FAZ:
Wir haben sehr viele Anfragen – nicht nur aus Berlin, auch aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Wir haben eine sehr, sehr lange Warteliste, die Zahlen haben sich in den letzten Jahren sicherlich verdoppelt, wir können gar nicht alle Jugendlichen aufnehmen.
Die offizielle Lesart ist, dass es diese vielen Transsexuellen schon immer gab und dass sie sich dank des Wirkens der Gender Studies erst jetzt hervorwagen. Eine zweifellos zulässige Hypothese, die zu prüfen wäre. Leider geschieht diese Prüfung nicht, sondern man legt sich einfach darauf fest, das zu glauben, und jagt jeden in die Wüste, der es wagt, eine andere Erklärung vorzuschlagen.
Die Studienlage zeigt (siehe auch hier), dass Geschlechtsdysphorie, also das Unwohlsein mit dem Geschlecht, bei 80 bis 95 Prozent aller davon betroffenen Kinder bis zur Adoleszenz von selbst wieder verschwindet. Bei vielen davon sind Dysphorie und geschlechtsuntypische Verhaltensweisen in der Kindheit lediglich ein frühes Anzeichen von Homosexualität. Hanna Sökeland ist ein Beispiel für beides.
Helen Joye:
… Seitdem haben sich ein weiteres Dutzend Studien in verschiedenen Ländern mit Kindern beschäftigt, die unter dem Gefühl litten, dem anderen Geschlecht anzugehören, das heute als Geschlechtsdysphorie bezeichnet wird. In jeder einzelnen ist die Mehrheit aus der Dysphorie herausgewachsen, und eine Mehrheit davon wiederum wurde im Erwachsenenalter schwul. Die jüngste und beste dieser Studien wurde im März 2021 veröffentlicht und hat 139 Jungen verfolgt, die zwischen 1975 und 2009 in einer Torontoer Klinik behandelt wurden und von denen zwei Drittel die klinischen Kriterien für eine Diagnose mit Geschlechtsdysphorie erfüllten. Sie ergab, dass mehr als 90 Prozent später keine Dysphorie mehr hatten und sich mit ihrem Geschlecht versöhnten, im Allgemeinen vor oder früh in der Pubertät.
Heute gilt aber die Doktrin der »Gender Affirmative Health Care«. Wenn ein Kind oder Jugendlicher behauptet oder vermutet, »trans« zu sein, also eine von seinem biologischen Geschlecht abweichende Geschlechtsidentität zu haben, darf niemand das in Frage stellen. Das gilt dann einfach als gesetzt.
Sibylle Winter von der Charité:
Wenn wir das nicht infrage stellen, können die jungen Menschen eigene Unsicherheiten zulassen und ihren Weg finden. Ihre subjektive Einschätzung ist für uns maßgeblich. Dabei ist die Haltung wichtig, dass Transsexualität heute nicht mehr als Krankheit gesehen wird, wie man früher noch dachte. Sondern ein subjektives Gefühl. Für uns bedeutet das: Wir prüfen nicht, wir stellen es nicht infrage. Wir schauen nicht, ob es wirklich so ist.
Nun werden Minderjährige wegen dieses subjektiven Gefühls nicht gleich operiert. Doch wenn die Pubertät naht, stellt sich unter Zeitdruck die Frage, ob Pubertätsblocker gegeben werden, um die Ausprägung von Geschlechtsmerkmalen zu unterbinden. Damit wird eine Weiche gestellt. Bei jüngeren Kindern ist es in den USA bereits Praxis, erst einmal »probeweise« eine »soziale« Transition zu vollziehen, etwa durch einen Wechsel des Namens und der Pronomen in der Schule und im Bekanntenkreis. Schulen machen das auch ohne das Wissen und gegen den Willen der Eltern.
Helen Joyce:
Dieser »gender-affirmative« Ansatz wird von einflussreichen Ärzten vertreten. Dazu gehört Diane Ehrensaft, Direktorin der Gender-Klinik am Kinderkrankenhaus San Francisco der University of California, die im Vorstand von Gender Spectrum sitzt, einer Aktivistengruppe in San Francisco. Ihr Buch The Gender Creative Child ist eine Anleitung für frühe Transitionen. Auf einer Veranstaltung von Gender Spectrum im Jahr 2016 behauptete Ehrensaft, dass ein Kleinkind mit nonverbalen »Gender-Botschaften« seinen Eltern eine Transidentität signalisieren könne. Ein männlich geborenes mag zum Beispiel die Träger seines Strampelanzugs lösen, um diesen wie ein Kleid aussehen zu lassen; ein weiblicher mag sich die Haarspangen vom Kopf pflücken. Sie behauptet, Kinder wüssten im zweiten Lebensjahr, ob sie transgender sind – tatsächlich »wissen sie es wahrscheinlich schon früher, aber das ist vorsprachlich«. Sie hat Eltern ermutigt, schon Kinder im Alter von drei Jahren sozial zu transitionieren.
Den Eltern präsentiert man sowohl die soziale Transition als auch Pubertätsblocker als leicht umkehrbar. Doch in Wirklichkeit sind sie die frühen Stufen dessen, was Ärzte eine »Interventionskaskade« nennen. […] Sehr wenige sozial transitionierte Kinder kehren zu einem Auftreten als ihr eigenes Geschlecht zurück, bevor sie medizinische Schritte folgen lassen. Johanna Olson-Kennedy, die Direktorin des Center for Transyouth Health and Development at Children’s Hospital Los Angeles, sagte Reuters, dass sie mehr als 1.000 Kinder in die soziale Transition begleitet hat, von denen nur eins den Prozess schließlich abgebrochen hat.
Im Unterschied zu 80 bis 95 Prozent Abbrechern, deren Dysphorie von selbst verschwindet, wenn man nicht »affirmiert«.
Auf der anderen Seite gibt es Studien, die zeigen sollen, dass die Gabe von Pubertätsblockern und Hormonen das psychologische Leiden der Betroffenen vermindere. Sie beruhen meist auf Befragungen der Patienten über den Zeitraum der Behandlung. Doch eine systematische Prüfung dieser Studien durch das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) des britischen National Health Service befand 2021, dass die Verlässlichkeit der Ergebnisse »sehr gering« und die Qualität der Evidenz »sehr niedrig« sei. Die Studien seien anfällig für Konfundierung und Bias. Soweit die Vorteile überhaupt real sind, fehlt eine Abwägung gegen die gesundheitlichen und psychologischen Kosten, und vor allem fehlt notgedrungen die Langfristperspektive. Dass Befragte im Rahmen kleiner, nicht repräsentativer Studien wenige Wochen oder Monate nach Beginn einer Hormonbehandlung angeben, sich besser zu fühlen, ist von begrenzter Aussagekraft.
Die Rückkehr der Geschlechternormen
Seit Längerem stelle ich immer wieder eine Beobachtung an: Wenn man die Wirklichkeit verleugnet, kommt sie irgendwann auf verschlungenen Wegen, in verdrehter Form und mit doppelter Gewalt zurück.
Ein Beispiel dafür ist in diesem Zusammenhang der klaffende Widerspruch zwischen der behaupteten Absicht der Aktivisten, Geschlechternormen zu überwinden, und der Praxis, Kinder und Jugendliche mit schwerwiegenden medizinischen Eingriffen in ebendiese Geschlechternormen einzupassen. Auf der einen Seite soll Geschlecht eine soziale Konstruktion sein; eine bloße durch Tradition weitergegebene Norm ohne Basis in der biologischen Wirklichkeit, und auf der anderen soll es eine »Geschlechtsidentität« geben, die eine natürliche, angeborene und unveränderliche innere Realität ist und in der Geschlecht genau so in Erscheinung tritt wie in den rein sozial konstruierten Geschlechternormen.
Helen Joyce:
Als Queer Theory die Universitäten erobert hat und die simplistische »im falschen Körper«-Version in die Populärkultur vordrang, fanden immer mehr Publikationen über Transkinder weite Verbreitung: Bilderbücher für Kinder, Romane für Teenager und Arbeitsbücher für Leser jedes Alters.
Soviel zu der Behauptung, es finde keine Beeinflussung statt. Bei Amazon fand ich in der Rubrik »Kinderbücher« in wenigen Minuten eine ganze Reihe von Büchern wie »Du bist nicht allein! LGBTQIA+ Community Handbuch: Wie Du Dich selbst finden kannst, Schritt für Schritt«, »Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*?: Dein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität«, »Queergestreift: Alles über LGBTIQA+« und »Leselauscher Wissen: Vielfalt Mensch« (»… So lernt sie durch Afna und Kofi etwas über Rassismus, feiert mit Johanna, die Trisomie 21 hat, Geburtstag und erfährt einiges über Geschlechts-Identitäten und die Liebe.«). Keine Ahnung, wie viele es davon gibt.
Die US-amerikanische TV-Serie für Vorschulkinder »Blue’s Clues« veröffentlichte im Mai 2021 ein Video, in dem die »Drag Queen« Nina West zu einer Zeichentrick-Pride-Parade sang und Kinder zum Mitsingen aufgefordert werden. Unter anderem ist ein Biber mit Narben von einer Brustamputation (technisch: »double mastectomy«; euphemistisch und üblich: »top surgery«) zu sehen.
Das (dafür heftig angefeindete und gedoxte) Twitter-Profil LibsofTikTok dokumentiert regelmäßig Drag-Queen-Veranstaltungen für Kinder und andere Aktivitäten von Transaktivisten; zuletzt etwa eine Person, die über Social Media Hormone zum Verkauf anbot und damit ausdrücklich Minderjährige ansprach.
Aber während man heute sonst so ziemlich alles mit Sozialisierung erklärt, geht man selektiv am Punkt der unsichtbaren, unbeweisbaren und inkohärent definierten »Geschlechtsidentität« davon aus, dass Kinder diese als festen Wesenskern mitbringen, der unbeeinflussbar wie ein Fels in der Brandung stehe. Was eine von vornherein unsinnige Annahme und durch empirische Tatsachen widerlegt ist; siehe oben.
Memifizierte Versionen zirkulieren in Social Media.
Hallo, »funk«.
Alle drücken denselben Widerspruch aus. Geschlechtsidentität ist ein angeborenes, nicht genau beschreibbares Gefühl ohne Bezug zu Körpertyp, Verhalten und Auftreten. Aber diese innere Wahrheit manifestiert sich in Stereotypen.
Selten liest man eine Geschichte über ein Transkind, die nicht Kleidung, Haare und Spielzeuge erwähnt. »Ich spielte nicht gerne mit Puppen und trug nicht gerne Kleider, und ich hasste es, lange Haare zu tragen«, sagt Transjunge Kit in Can I tell you about Gender Diversity? In Introducing Teddy: A Gentle Story About Gender and Friendship, wird Teddy ein Mädchen, indem er seine Fliege in eine Haarschleife verwandelt.
Man könnte oben einwenden, dass Hanna Sökeland doch gar nicht dachte, sie sei ein Junge; sie sagt nur, dass sie maskulin wirkte. Aber das macht die Sache nur schlimmer. Es braucht gar keine Dysphorie, um für trans erklärt zu werden. Geschlechtsuntypisches Verhalten genügt. Weil sie maskulin wirkte, wäre Sökeland von allen Seiten aufgefordert und ermutigt worden, darüber nachzudenken, ob sie vielleicht ein Junge sei, in sich hineinzufühlen, um den Jungen oder das Mädchen zu finden, Bestand aufzunehmen, ob sie Jungendinge oder Mädchendinge mag und so weiter. Gleichzeitig wäre das in einem sozialen Klima geschehen, in dem Transkinder als wunderbar, interessant und vielfältig und die durchschnittlicheren im besten Fall als langweilig, im schlimmsten als ewig schuldige Unterdrücker dastehen, insbesondere wenn sie weiß sind.
Detransitioner, also Personen, die ihre Transition rückgängig gemacht haben, soweit möglich, beschreiben dies immer wieder als wesentliche Dynamik. Die äußerst lesenswerte Geschichte von Helena Kershner ist ein Beispiel dafür. Ein normales heterosexuelles Mädchen ist sofort verdächtig und hat aufgrund seiner Privilegiertheit keinerlei Anspruch auf Mitgefühl, was insbesondere dann ungünstig ist, wenn dieses Mädchen leidet und Beistand sucht. Eine Transidentität löst dieses Problem sehr effektiv, zumal es online zunächst einfach und kostenlos ist, eine anzunehmen.
Danke, Wokeness. Gute Arbeit mal wieder.

Abigail Shrier in »Irreversible Damage«:
Tatsächlich bestehen die Kalender so vieler Schulen darauf, dass LGBTQ-Schüler nicht nur gleich und fair behandelt, sondern für ihre Tapferkeit bewundert werden. Die ganzjährige Pride-Parade beginnt oft im Oktober mit dem »Coming-Out-Tag«, dem »Internationalen Pronomen-Tag« und dem Monat der LGBTQ-Geschichte; der November bringt die »Transgender-Bewusstseins-Woche« und endet mit dem »Transgender-Tag des Erinnerns«, einer Mahnwache für Transgender-Individuen, die aufgrund dieser Identität ermordet wurden. Der März ist »Monat der Transgender-Sichtbarkeit«. Der April trägt den »Tag der Stille«/»Tag des Handelns« bei, um die Sensibilität für Mobbing gegen LGBTQ-Schüler zu schärfen. Der Mai hat den »Harvey-Milk-Tag« im Angebot, der der Trauer um den prominenten Schwulenrechtsaktivisten gewidmet ist; und der Juni ist natürlich der Pride Month – 30 Tage, die der Feier von LGBTQ-Identitäten und der Verurteilung von LGBTQ-Unterdrückung gewidmet sind.
Aber das alles beeinflusst Kinder und Jugendliche überhaupt nicht; es lässt nur hervorkommen, was unabhängig davon authentisch und unveränderlich da ist. Na klar.
In diesem Zusammenhang ist auch das von der Ärztin Lisa Littman so beschriebene Phänomen der »Rapid Onset Gender Dysphoria« (ROGD) zu erwähnen. (Alle folgenden Informationen ohne Link entnehme ich dem Buch »Trans« von Helen Joice.) Littman war zufällig aufgefallen, dass sich in einem bestimmten sozialen Umfeld neuerdings mehrere Mädchen als trans identifizierten, was statistisch sehr unwahrscheinlich ist, wenn die Grundlagen dafür angeboren sind und nur höchstens bei einer Person von 30.000 bis 100.000 auftreten, wie man damals schätzte. Sie führte eine Befragung unter Eltern durch, die sich online darüber austauschten, dass ihre Töchter in jugendlichem Alter plötzlich Jungen sein wollten, und veröffentlichte die Ergebnisse 2018 in einer Studie.
Die meisten Eltern gaben an, dass ihre Töchter vor der Verkündigung einer Trans-Identität mehr Zeit online verbracht hatten und/oder Freundinnen hatten, die sich ebenfalls als »trans« identifizierten, oder beides. Fast zwei Drittel waren bereits einmal mit einer psychiatrischen oder Entwicklungsstörung diagnostiziert worden, viele hatten selbstverletzendes Verhalten gezeigt. Die Bezeichnung »ROGD« spielt außerdem darauf an, dass das bekannte Phänomen der Geschlechtsdysphorie normalerweise in der frühen Kindheit erstmals auftritt. Das plötzliche Auftreten in der Pubertät oder Adoleszenz ist ebenso wie die Masse an betroffenen Mädchen etwas Neues. Das alles legt nahe, dass die Trans-Identifikation in vielen Fällen durch eine Art sozialer Ansteckung zustande kommt, ähnlich wie Magersucht oder eben Selbstverletzung. Dies würde erklären, dass die neuen Trans-Jugendlichen meist Mädchen sind, weil in erster Linie Mädchen für solche psychischen Epidemien anfällig sind.
Auf die Publikation der Studie folgte der unvermeidliche Shitstorm samt Hetz- und Verleumdungskampagne gegen Littman, die sie schließlich ihren Teilzeitjob als Beraterin beim Rhode Island Department of Health kostete. Jeder Arzt oder Wissenschaftler, der sich gegen das Narrativ stellt, darf damit rechnen, verleumdet und auf Druck der Aktivisten schließlich gefeuert zu werden. So ging es auch Ken Zucker, der 1984 Leiter einer Genderklinik für Kinder in Toronto wurde, in mehreren Studien feststellte, dass kindliche Geschlechtsdysphorie meist von selbst wieder verschwindet, und deswegen dafür eintrat, den betroffenen Kindern möglichst zunächst dabei zu helfen, sich mit ihrem Körper zu versöhnen, statt sie gleich für trans zu erklären. Im Jahr 2015 kündigte seine Klinik eine Prüfung seiner Arbeit an und warf ihm schließlich vor, Patienten traumatisiert, Konversionstherapie betrieben und einen jungen Transmann in einer Überweisung als »haarigen kleinen Wurm« bezeichnet zu haben. Er wurde gefeuert und seine Einheit geschlossen.
Alle Vorwürfe gegen Zucker wurden später von dem Journalisten Jesse Singal widerlegt. Sie beruhten auf Verwechslungen oder waren frei erfunden. Zucker verklagte die Klinik und bekam recht. Die Klinik entschuldigte sich und nahm alles zurück. Doch nicht jeder Betroffene hat das Glück, dass die Sache mit einer offiziellen und öffentlichen Entlastung endet, und der Job ist natürlich trotzdem weg. Man kann viele solche Geschichten erzählen.
Der Littman-Studie wird vorgeworfen, methodisch mangelhaft zu sein. Der Hauptpunkt ist dabei die Selektivität der Stichprobe. Die befragten Eltern waren nicht repräsentativ für die Gesamtheit der Eltern von Trans-Jugendlichen, sondern waren eben besorgte Eltern, die Zweifel an der angeborenen, natürlichen und heilsamen Trans-Identität ihrer Töchter hatten. In der Tat ist die Aussagekraft der Daten durch die Selektivität der Stichprobe beschränkt.
Aber die Studie hat nie behauptet, repräsentative Aussagen über eine Population zu treffen oder ein endgültiger Beweis zu sein. Auch die Studien an bestimmten Kohorten von Transpersonen an bestimmten Kliniken sind nicht repräsentativ für irgendetwas. Das ist überhaupt nicht ihr Anspruch. Littmans Studie behauptet dementsprechend nicht, die Frage zu beantworten, wie häufig ROGD vorkommt, sondern sie legt ein paar deutliche empirische Anzeichen dafür vor, dass ROGD existiert. Sie wirft ein Licht auf mögliche Zusammenhänge, die man sich näher ansehen sollte in Anbetracht der Massen an trans-identifizierten Mädchen und der Tatsache, dass es für die plötzliche Explosion der Zahl keine befriedigende und gesicherte Erklärung gibt. Ein möglicher Bias der Eltern erklärt auch nicht das Auftreten von adoleszenter Trans-Identifizierung in Clustern, und dass es online reichhaltig Materialien und Influencer gibt, die Jugendliche persuasiv zur Annahme einer Trans-Identität ermutigen, sowie Communitys um diese Materialien und Influencer herum, ist keine Hypothese, sondern eine Tatsache. Detransitioner bestätigen das Phänomen »ROGD« aus eigener Erfahrung. Lisa Littman nahm ausführlich zur Kritik an ihrer Arbeit Stellung und argumentierte, ihre Methodik sei im Einklang mit dem, was in der Forschung zu Geschlechtsdysphorie üblich und anerkannt sei.
Die schon genannte Diane Ehrensaft kommentierte Studie mit der Bemerkung, besorgte Eltern aus Online-Foren zu befragen, sei ja, als würde man den Ku-Klux-Klan darüber befragen, ob Schwarze wirklich minderwertig seien. Besorgte Eltern als Äquivalente zu Nazis – das haben wir so ähnlich auch schon von unserem Queer-Beauftragten Sven Lehmann gehört. Ähnliches bekommen Jugendliche auch von Transaktivisten zu hören. Wenn eure Eltern Bedenken gegen eure Transition anmelden, dann haben sie einfach nichts verstanden, sind von gestern, intolerant, transphob und gegen euch.
Sibylle Winter von der Charité:
Es gibt weltweite Studien, dass es mehr Mädchen sind, die Jungen werden wollen. Es wird vermutet, dass der Grund für das Auseinanderklaffen ist, dass Transmädchen sich viel später outen, weil sie noch mehr diskriminiert werden als Transjungen. Die werden sozial sehr viel weniger akzeptiert.
Es wird vermutet. Na dann.
Die Illusion des Wissens
Ich befinde mich in einem Dauerzustand des Staunens darüber, wie niveaulos die Debatte über den Anfang Juni erschienenen Aufruf »Schluss mit der Falschberichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks« geführt wurde und wird. Vor allem verblüfft mich die Illusion des Wissens, von der die Gegner des Aufrufs beseelt sind, in Verbindung mit ihrer absoluten Gewissheit über den eigenen Standpunkt.
Sie springen unmittelbar zu der Auffassung, dass die Urheber und Unterstützer des Aufrufs nur durch »Hass« auf Transsexuelle oder allenfalls durch das Beharren auf einem rechtskonservativen Weltbild motiviert sein könnten, in dem nur für Heterosexuelle Platz ist. Was für ein Kurzschluss! Das ist etwa so, als ob ich aus Gründen, die ich konkret benennen und belegen kann, eine bestimmte Psychotherapieform oder Krebsbehandlung für die falsche Strategie halte und daraufhin automatisch angenommen wird, dass ich die Patienten »hasse«, die mit diesen Therapien behandelt werden, ohne dass meine Gründe je angehört würden.
Diese Annahme und Reaktion ergibt nur dann Sinn, wenn man unterstellt, man habe absolute Gewissheit darüber, dass diese Therapien richtig sind, und ich, der Kritiker, hätte diese Gewissheit ebenfalls. Denn wenn zumindest ich sie nicht hätte, könnte ich wenigstens durch falsche Prämissen motiviert sein statt durch »Hass«.
Die Reaktionen sind völlig reflexhaft. Diese Menschen kennen den Forschungsstand nicht. Sie wissen nicht, was an Schulen und in Kindergärten abläuft. (Ich weiß es auch nicht genau, aber im Unterschied zu ihnen weiß ich, dass ich es nicht weiß. Deshalb hätte ich gerne, dass es geklärt wird.) Sie wissen nicht, was in Genderkliniken abläuft. Sie wissen nicht, was im ÖRR im Einzelnen gezeigt und behauptet und von dem Dossier kritisiert wird, das den Aufruf begründet und das fast niemand gelesen hat. Sie wissen nicht, wie vielen Menschen es nach einer Trans-Behandlung besser oder schlechter geht und wie ihre langfristige Prognose aussieht. Sie wissen nicht, was genau Pubertätsblocker und Hormoninjektionen im Körper bewirken, was bei den »geschlechtsangleichenden« Operationen genau passiert, wie hoch die Komplikationsrate ist (hoch) und wie sich das alles wiederum auf die Psyche auswirkt. Sie wissen nicht, was den explosionsartigen Anstieg der Zahl von Jugendlichen auslöst, die sich als »trans« identifizieren – selbst entschiedene Befürworter der »trans affirmative health care« gestehen zu, dass das niemand sicher weiß. Sie wissen nicht, wie eine entwicklungspsychologisch optimale, nach Altersgruppen gestufte Sexualaufklärung von Kindern aussehen müsste und wie sich das Programm des ÖRR dazu verhält. Und so weiter.
Aber sie reagieren so, als wüssten sie das alles ganz genau. Als wäre das alles simpel. Als müsste man nur eine allgemeine Haltung der Toleranz und Progressivität verkünden und dadurch wären wie durch ein Wunder alle Fragen zur vollen Zufriedenheit jedes vernünftigen Menschen beantwortet. Als übersetzte sich der gute Wille automatisch in gute Strategien und Ergebnisse. Als beschränkte sich die Komplexität des Ganzen auf die Alternative Daumen hoch / Daumen runter. Das Sahnehäubchen auf dieser Absurdität ist, dass sich diejenigen, die sich blind diesen Reflexen hingeben, für nicht nur moralisch, sondern vor allem auch intellektuell überlegen halten. Für aufgeklärte, differenzierte Denker.
Konformität ist Default
Aber eigentlich sollte ich darüber nicht staunen, denn ich kann mir das durchaus erklären. Ich habe meine Erklärung oben schon gestreift. Diese Leute vertrauen den Experten und Institutionen. Das fehlende Wissen ist ausgelagert. Sie selbst haben es nicht, aber sie nehmen an, dass sie wüssten, wer es hat, und dass es also klug und richtig sei, sich auf die entsprechenden Akteure und Instanzen zu verlassen.
Das ist im Allgemeinen richtig so und unvermeidlich. Doch Experten und Institutionen können auch versagen und korrupt werden. Es ist eine Binsenweisheit, dass es keine gesellschaftliche oder professionelle Gruppe gab, die sich 1933–45 geschlossen widersetzt hätte. Die Kirchen nicht, die Ärzte nicht, die Sozialwissenschaftler nicht, die Künstler nicht, die Journalisten nicht etc. Sie haben alle mitgemacht. Es gab überall Einzelne, die sich widersetzt haben, aber eben nur Einzelne und höchstens kleine Widerstandsnester.
Es ist natürlich ein Unterschied, dass damals eine autoritäre Diktatur mit politischer Justiz das Geschehen bestimmt hat. Aber es brauchte eben in den meisten Fällen gar nicht den direkten Zwang, um die Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Sie waren von sich aus motiviert oder haben es zumindest vor sich gerechtfertigt, auch ohne direkt bedroht gewesen zu sein. Selbst für die Armee, wo tatsächlich mit direkten Befehlen gearbeitet wird und Gehorsamsverweigerung Konsequenzen hat, wurde der sogenannte Befehlsnotstand als Mythos entlarvt. Es gab nicht in großem Maßstab Bestrafungen von Soldaten, die sich der Beteiligung an Kriegsverbrechen verweigert haben. Die brauchte es nicht.
Die menschliche Neigung, Verantwortung an Kollektive und Autoritäten abzugeben, ist stark. Sie sind sich meist gar nicht im Klaren darüber, dass sie das tun, weil es einfach selbstverständlich ist, wie das Wasser für den Fisch. Sie können sich oft gar nicht vorstellen, den Experten und Institutionen nicht zu trauen, und halten daher diejenigen, die es nicht tun, unwillkürlich für dumm, bösartig oder verwirrt.
Die Vertrauenskrise
Die große Vertrauenskrise, die man unter anderem auch an der Corona-Thematik studieren kann, stellt uns vor ein Dilemma. Auf der einen Seite brauchen wir soziales Vertrauen, also Vertrauen füreinander, aber auch für Institutionen, Autoritäten und Experten. Auf der anderen sehen wir, dass sie in Teilen eben evident nicht vertrauenswürdig sind. Durch Social Media bekommen das auch mehr Menschen mit, als es früher mitbekommen hätten. Wenn wir nun aber ein allgemeines Redpilling derart hätten, dass niemand mehr den Institutionen und Experten vertraute, würden wir in eine Turmbau-zu-Babel-Situation geraten, zumindest vorübergehend. Wir könnten nichts mehr glauben, was wir nicht persönlich bezeugt haben. Wir könnten über nichts mehr übereinkommen, außer über sektenartige Dogmen, die sich in verschiedenen Gruppen heranbilden. Und jedes Thema auf wissenschaftlichem Niveau selbst zu recherchieren und zu durchdringen ist so oder so unmöglich.
Wir können nicht ohne die Institutionen. Das heißt, wir müssen sie nicht bekämpfen, sondern um sie kämpfen. Die Prinzipien hochhalten und verteidigen, nach denen sie funktionieren sollten. Ihre Korruption aufzeigen und darauf drängen, dass sie korrigiert wird. Die Wahrheit sagen, auch wenn wir wissen, dass uns das Beschimpfung und Verachtung durch (meist wenige, aber laute) andere einbringt. John McWhorter ruft in »Woke Racism«/»Die Erwählten« die Amerikaner dazu auf, sich daran zu gewöhnen, von den Wokemon öffentlich als »Rassisten« beschimpft zu werden. Alles andere würde bedeuten, die Fundamentalisten gewinnen zu lassen und dem aufgeklärten Zeitalter Lebewohl zu sagen, denn es ist unvermeidlich, dass sie einen als »Rassisten« beschimpfen, wenn man sich außerhalb ihrer Orthodoxie zu dem Thema äußert.
Es ist im Großen und Ganzen vernünftig, dass Menschen erst einmal eher den Experten und Institutionen (und echten oder scheinbaren Mehrheiten) glauben als irgendwelchen Stimmen im Internet. Aber auch die öffentliche Meinung durchläuft ihre Wandlungen, und die Sozialpsychologie weiß, dass schon wenige abweichende Stimmen genügen, um Zweifel über auf Konformität beruhende Scheingewissheiten zu säen. Die Heftigkeit des Geschreis der Aktivisten, wenn solche Stimmen laut werden, verweist darauf, dass sie es intuitiv auch wissen.
LGB und T sind nicht das Gleiche
Ich bin froh und dankbar für jede Hanna Sökeland, die ein maskulines Mädchen sein und später ihre weibliche Seite entdecken darf und mit beiden Seiten im Frieden ist, sowie für jeden Jungen, auf den das Umgekehrte zutrifft. Früher konnten die Konservativen so etwas nicht aushalten, heute können es die Linken nicht. Hoffen wir, dass das Pendel irgendwann in der Mitte zur Ruhe kommt und nicht immer wieder in die Extreme ausschlägt. Es ist in Ordnung, wenn ein Mädchen nicht mädchenhaft ist. Es ist aber auch in Ordnung, wenn es das ist. Vielen Menschen stellt dieser extreme Standpunkt, den ich vertrete, vor große kognitiv-emotionale Herausforderungen.
Aber was, wenn das Mädchen »trans« ist, warum ist das nicht in Ordnung? Es ist zunächst einmal insofern objektiv nicht in Ordnung, als es mit Leiden und oft schweren medizinischen Eingriffen verbunden ist. Das ist ein Problem, das nichts mit meinen Präferenzen oder Meinungen zu tun hat; es ist ein Problem für die Betroffenen, das sich für Schwule und Lesben überhaupt nicht stellt. Die kann man einfach akzeptieren und in Ruhe lassen. Man muss sie nicht operieren, man muss keine neuen Pronomen erfinden, man muss nicht fundamentale Realitäten bestreiten und man muss nicht so tun, als ob sie etwas wären, das sie nicht sind.
Ich setze »trans« manchmal in Anführungsstriche, weil nicht klar ist, was Menschen mit »trans sein« überhaupt meinen. Die Prämisse, dass man von Geburt »trans sein« kann, wie man beispielsweise rothaarig sein oder Blutgruppe A haben kann, ist unbelegt und scheint mir unplausibel. Die These, dass Menschen, die in diesem Sinn einfach »trans sind«, ein normaler Teil natürlicher Vielfalt seien, der nur im Licht veralteter sozialer Normen als problematischer Sonderfall erscheine, beißt sich mit dem Umstand, dass eben jene schwerwiegenden medizinischen Behandlungen nötig sind. Warum sollte eine biologische Spezies in hoher Zahl Individuen hervorbringen, die einen Konflikt mit der Geschlechtlichkeit des eigenen Körpers verspüren, der sich nur durch medizinische Hochtechnologie lösen lässt, und noch nicht einmal das so richtig?
Es ist denkbar, dass es sich dabei um eine Art Entwicklungsstörung oder eine psychologische Reaktion auf frühe Kindheitserlebnisse handelt. Dies würde ich vermuten. Aber die These, dass es normal und natürlich sei, widerspricht, noch einmal, dem Leiden und dem Behandlungsbedarf. Sie ist in sich inkohärent.
Nun kann man sagen: Wo auch immer es herkommt, es ist nun mal da und es muss darum gehen, die Betroffenen zu unterstützen. Soweit einverstanden: Wenn es für eine Person das Beste ist, sich als das andere Geschlecht zu definieren und zu präsentieren, genauer ausgedrückt: wenn dies für eine Person unterm Strich eine bessere Lebensqualität bringt als jede Alternative, dann akzeptiere ich das und unterstütze diese Lösung. Und ich glaube auch, dass solche Fälle existieren.
Aber dass dies auf die Masse der Fälle zutrifft, glaube ich aus oben beschriebenen Gründen keine Sekunde. Ich halte das, was mit dieser Masse von Kindern und Jugendlichen gemacht wird, für ein Verbrechen in großem Maßstab. Nicht weil ich mich an der Existenz von Transsexuellen stören würde, sondern wegen des Leids, das diesen Kindern und Jugendlichen widerfährt. Mit meinen persönlichen Präferenzen hat das nichts zu tun, außer mit derjenigen, unnötiges Leid zu verhindern.
Ein rationaler und humaner Umgang mit dem Thema müsste äußerste Sorgfalt darauf verwenden, keine Minderjährigen einer Trans-Behandlung zu unterziehen, bei denen keine Gewissheit darüber besteht, dass ihnen dies die bestmögliche Lebensqualität eröffnet, weil andauernde Dysphorie mit andauerndem Leiden verbunden wäre. Und er müsste sich um eine Sexualaufklärung bemühen, die sexuellen Minderheiten möglichst viel Diskriminierung erspart, ohne die übrigen Kinder unnötig zu verwirren (und ohne Erstere zusätzlich zu verwirren).
Was gegenwärtig passiert, ist weit von diesem vernünftigen Szenario entfernt. Die Institutionen sind ideologisch gekapert. Dabei sind verschiedene Motivationen im Spiel. Teils ist es einfach guter Wille und ein fehlgeleitetes, schlecht informiertes Bemühen um Mitgefühl und Toleranz; teils ist es Konformität (s.o.), teils ist es eine billige Möglichkeit für Narzissten, einen unverdienten Status moralischer Überlegenheit einzunehmen und/oder Mobbing- und Missbrauchsverhalten frei auszuleben. Bei den betroffenen Jugendlichen ist es Leid, Verwirrung und Identitätssuche.
Der ideologische Kern ist ein sozialer Utopismus, der glaubt, die Menschen durch das Einreißen sozialer Normen zu »befreien«, so dass sie ihr wahres Selbst entdecken und im Einklang damit leben können. Klingt gut, nur dass manche sozialen Normen durchaus ihren Sinn haben, weil Menschen keine beliebig programmierbaren (oder de-programmierbaren) unbeschriebenen Blätter sind und dieser Utopismus längst zu dem Versuch übergegangen ist, uns auch von unausweichlichen Realitäten zu »befreien«, indem er sie leugnet und vernebelt. Erstaunlich auch, dass niemandem aufzufallen scheint, dass dies exakt dieselbe Ideologie ist, die unter einflussreichen linken Intellektuellen sowie bei den Grünen einmal die Idee der Pädophilie legitimiert hat. Normen sind ein Gefängnis, jenseits der Normen liegt die Freiheit.
Manchmal ist das so. Aber nicht immer. Jenseits sozialer Normen liegen noch ganz andere Dinge. Die sollte man auch auf dem Schirm haben.
